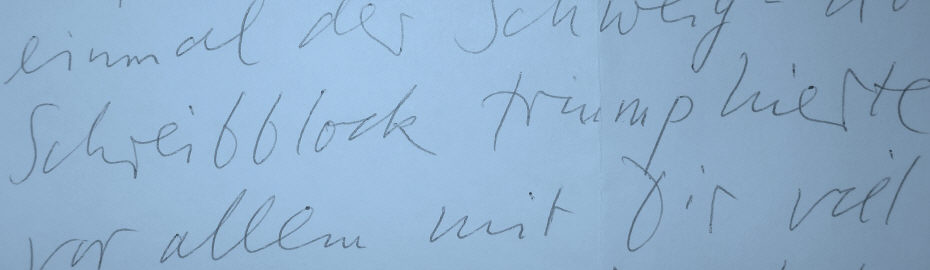Die Nase läuft weg
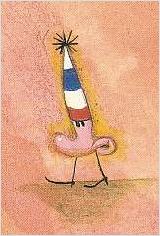
Winterwünsche wirken oft bescheiden. Schneidet Kälte ins Gesicht, sehnen wir uns danach, eine Zeitlang von der wundgeputzten Nase lassen zu dürfen. Franzobel geht in seinem ersten Kinderbuch einen Schritt weiter. Sein Held lebt schnupfenfrei, denn seine Nase ist ausgebüxt. Wie das?
Gottfried ist jung, schön, gesund, aber nicht makellos: Seine Nase ist zu groß, da hilft der Trost der Familie wenig. Wenn er schläft, machen sich sogar Augen, Ohren und Mund über den kapitalen Zinken lustig. Gottfried in Not: »'Was ist, wenn sie noch weiter wächst? Immer weiter, rund um die Welt? Dann wäre ich eine Verkehrsbelästigung.'« Dieses zartrosa Unding muss weg – und eines Nachts erfüllt sich sein Wunsch.
Vorbei an einer Schnarchfontäne verlässt die geschmähte Nase das Haus und zieht in die Welt. Ein schmerzvolles Abenteuer jagt das andere: Eine Maus hält sie für französischen Käse, ein Ohrenkehrer kehrt am falschen Ort, ein böser Käfer sticht zu und ein scheinbarer Nasengott knetet sie nach Leibeskräften durch. In der Welt verloren, sucht die Nase ihren Platz. Ihre Odyssee endet, wo sie begonnen hat: mitten in Gottfrieds Gesicht. Noch einmal Glück gehabt, Gottfried!
Auch wenn Franzobel die schwächste aller Lösungen wählt – alles nur ein Traum –, reizt das hübsch schräg illustrierte Buch zum Nachdenken über die Ordnung der Welt, über Selbstannahme und natürlich über laufende Nasen. Franzobels krautflutender Fantasie lässt der wohlmeinende (Vor-)Leser den sehenden Maulwurf und das lahme Spiel mit dem Wort Nase durchgehen. Gerührt greift er ob des windelweichen Endes zum Taschentuch, und zwar nicht nur winters.
Franzobel / Sibylle Vogel: Die Nase. Wien: Picus 2002.
Westfälische Nachrichten, 28. Dezember 02
»Jerusalem« ohne Stühle, Tanztheater ohne Tanz

Moritz Eggert ist ein junger Pianist aus Süddeutschland. Am Samstag abend trat er im Rahmen der »TanzTheaterTage '96« im Kleinen Haus der Städtischen Bühnen Münster auf, wo er seine in den Jahren 94/95 komponierte musikalische Performance »Hämmerklavier« aufführte. Den Laien mag es zunächst irritieren, daß ein Pianist bei einem Festival des Tanztheaters auftritt; Kenner des Genres beantworten die Frage, warum Eggert durchaus zum modernen Tanztheater gerechnet werden kann, jedoch denkbar einfach: weil er nicht tanzte.
Eggerts »Hämmerklavier« besteht aus zehn kurzen Teilen, die knapp 90 Minuten in Anspruch nehmen. Der korrekt gekleidete Pianist – schwarze Weste und Hose, weißes Oberhemd – schaute beim Spielen in der Regel tief in die Tasten, wobei er seinen ganzen Körper in rhythmischem Umwogtsein musikalisch aufzulösen versuchte. Vogelartiges Hacken des Kopfes, stampfende Füße und klopfende Hände schienen Ausdruck einer unbezähmbaren Künstlernatur. Mitunter verlor er gänzlich die Kontrolle, griff in ekstatischer Übersteigerung über den rechten Tastenrand hinaus und schlug schier unermüdlich aufs Holz.
Während die diversen Schreie bei Eggerts »Fallstudie« wohl den Schmerz beim Fallen versinnlichen sollten, ließ er auch seine übrigen Kompositionen durch gekonntes Bellen, Heulen, Gewinsel, Prusten und Stöhnen nie eintönig erscheinen. Ein Höhepunkt des Abends war jedoch nach der Pause »Hämmerklavier IX«, das den bezeichnenden Titel »Jerusalem« trug. Eggert näherte sich mit viel Ironie und künstlerischem Basiswissen einem zu Unrecht beliebten Gesellschaftsspiel, bei dem in der Regel weniger Stühle als Spieler vorhanden sind. Der Münchener Pianist radikalisierte die Spielform zu einem Einpersonenstück, das gänzlich ohne Stühle auskommt. Während Eggert um den Flügel rannte, mußte er lediglich darauf achten, daß ihm nicht das Hemd aus der Hose rutschte. Er demonstrierte, daß Stühle völlig überflüssig sind, wenn man nur in Bewegung bleibt.
Nicht zuletzt solche Leistungen verhalfen dem jungen Musiker für 1996/97 zu einem Stipendium in der vermutlich schalldichten Villa Massimo, die nur wenige auserwählte Künstler betreten dürfen. Rund 36 Zuschauer verschafften Eggert eine positive Resonanz und sorgten im gut besuchten Kleinen Haus für eine enthusiastische Avantgarde-Stimmung, die unter Stampfen und Johlen das traditionell Provokative der Darbeitung schnell vergessen ließ. Wie anregend und vielfältig der Abend auf die Zuhörer wirkte, belegt die Äußerung Andreas von Seggerns, eines jungen Musik-Fans aus Oldenburg, der die Performance auf folgende Frage zuspitzte: »Was versteht ein Weißer unter Soul?«
Westfälische Nachrichten, 3. Juni 96